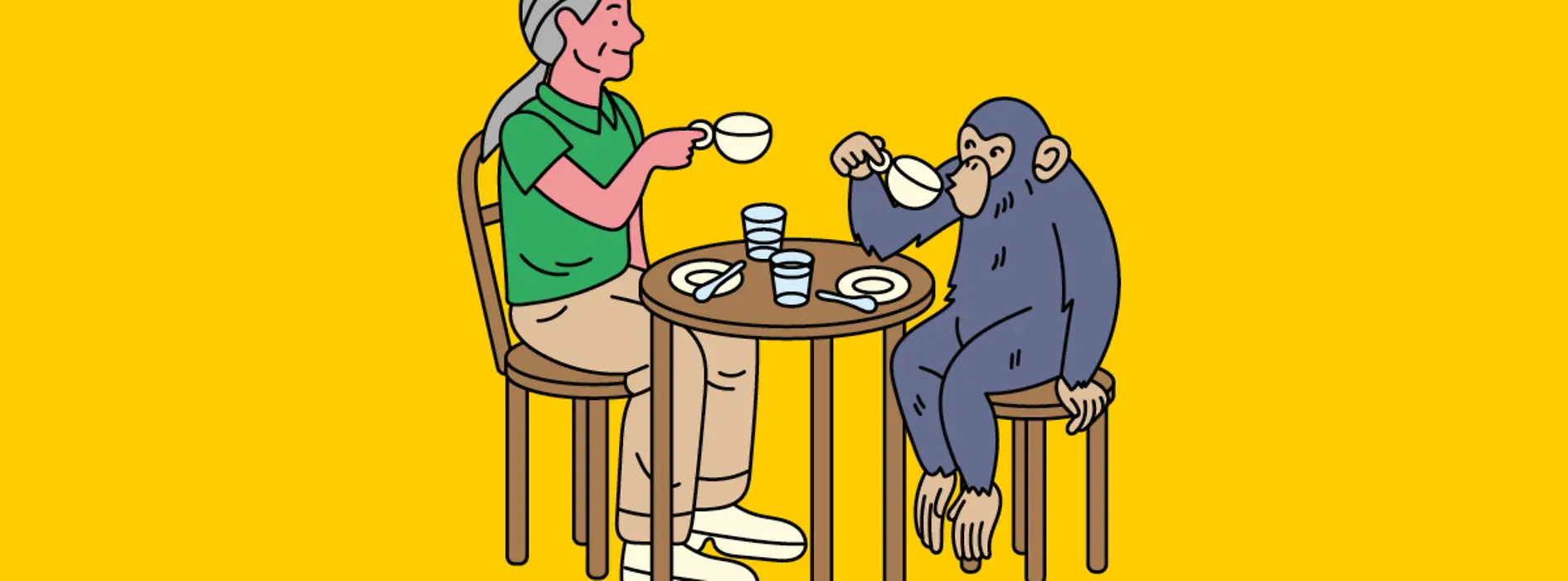Zeit die Welt zu retten!
„Schimpansen zerstören ihren Lebensraum nicht mutwillig“
Vor 65 (!) Jahren begann Dame Jane Goodall, Schimpansen in Tansania zu studieren. Die Erkenntnisse der britischen Verhaltungsforscherin revolutionierten nicht nur die Sichtweise auf unsere nächsten Verwandten. Sie veränderten auch den Blick auf die Spezies Mensch. Ihre Arbeit inspirierte Generationen von Wissenschaftler:innen. Bis heute ist die 91-Jährige im Einsatz, hält Vorträge und engagiert sich für eine bessere Welt – für Affen und Menschen. Für den WienTourismus hat sie sich die Zeit genommen, darüber zu sprechen, warum Schimpansen nicht in Städten leben und was wir von den intelligenten Tieren lernen können.
Schimpansen und Menschen sind sich sehr ähnlich. Sie haben einmal gesagt: „Das Einzige, was uns von Schimpansen unterscheidet, ist die Sprache.“ Sie leben in Gruppen, stellen Werkzeuge her, können Emotionen zeigen, Fehler erkennen, genauso bösartig sein wie Menschen. Wenn sie uns so ähnlich sind: Warum haben Schimpansen nie Städte gegründet wie wir Menschen?
Schimpansen leben in den Regenwäldern nicht an einem bestimmten, kleinräumigen Platz, sondern bewohnen Territorien in einer Größe von sechs bis 95 Quadratkilometern. Als Allesfresser betreiben sie nicht nur Jagd, sie begeben sich auch jeden Tag aktiv auf die Suche nach Bäumen, die Früchte tragen. Das wechselnde Angebot an Nahrungsquellen zu unterschiedlichen Zeiten zwingt sie dazu, oft weite Strecken in den Wäldern zurückzulegen. Das ist einer der Gründe, warum sie sich nicht an einem fixen Ort niederlassen.
Stellen wir uns vor, Schimpansen würden in Städten leben. Wie würden diese Städte aussehen, wie wären sie organisiert? Was würde diese Siedlungen von unseren heutigen Städten unterscheiden?
Um ehrlich zu sein, kann ich mir das nicht besonders gut vorstellen. Aber rein in Bezug auf ihre Lebensweise und ihre artspezifischen Gewohnheiten, müsste es viel mehr Grünflächen geben, Parks mit großen Bäumen. Und diese Flächen müssten miteinander verbunden sein. Keine kleinen, grünen Inseln umgeben von Beton oder nur einzelne Sträucher oder Bäume in Gefäßen, die zur Zierde dienen. Grünflächen ohne Barrieren, die das Wechseln von einem Gebiet zum anderen für die Wildtiere ermöglichen. Ohne breite Straßenzüge mit rasendem Verkehr, die zu lebensgefährlichen Grenzen werden, die eine Wanderung in ihrem Territorium unmöglich machen und eine tödliche Gefahr darstellen. Es bräuchte Wasserstellen und Plätze, wo sie Nahrung finden und Bäume, auf die sie sich zurückziehen können.
Wir Menschen stammen von den Menschenaffen ab und einige unserer Verhaltensweisen könnten auf diese primitiven Zeiten zurückgehen. Gibt es etwas, was wir Menschen von den Schimpansen lernen können, wenn es um das Zusammenleben geht?
Schimpansen und wir Menschen haben unsere gemeinsamen Wurzeln in Afrika – ein Grund warum mein Mentor Louis Leakey, dessen großes Interesse den Vorfahren der heutigen Menschen galt, mich nach Gombe, Tansania schickte. Er wollte mehr über unsere Entwicklung, unsere Gemeinsamkeiten mit den Schimpansen, aber auch vorhandene Unterschiede erfahren. Es gibt so viele Ähnlichkeiten in unseren Verhaltensweisen und man muss sich wirklich bewusst sein, dass etwa 99 Prozent unserer DNA-Zusammensetzung ident sind. Dank meiner Beobachtungen konnte ich vieles über die Strukturen innerhalb einer Schimpansen-Gruppe erfahren. So festigen sie ihre sozialen Bindungen durch gegenseitige Fellpflege. Dieses „Grooming“ ist nur eine Handlungsweise, um die Gunst ihrer Artgenossen zu erlangen. Da sind sie uns auch sehr ähnlich! Sie zeigen sich auch empathisch. Die Mitglieder der Gemeinschaften verhalten sich ihren Gruppenmitgliedern gegenüber solidarisch, hilfsbereit und fürsorglich. Ich bemerke heute oft, dass es vielen Menschen an Empathie fehlt. Mehr Solidarität, gegenseitiges Verständnis und Handlungsweisen, die nachhaltig das Leben vieler positiv beeinflussen, wären so wichtig. Aber es gibt noch einen anderen Aspekt, wo wir von Schimpansen lernen sollten: Sie zerstören ihren Lebensraum nicht mutwillig.
Ihre Einschätzung als Verhaltenswissenschaftlerin: Ist das Leben in Städten die beste Option für den Menschen in Bezug auf die Zivilisation?
Ich denke, es ist sehr individuell zu betrachten und wie jeder Mensch sein Leben führt, wie die Arbeitssituation aussieht und all jene Faktoren, die unseren Alltag ausmachen. Es gibt durchaus Vorteile. Aber als Umweltaktivistin, als Friedensbotschafterin und als nun 91-Jährige, die auf viele Veränderungen in den vergangenen Jahrzehnten zurückblicken kann, sehe ich so manche Entwicklungen sehr kritisch. Denken wir an den enormen Energieverbrauch, die Umweltproblematik, den Müll, aber auch wie sich das Leben, die Anonymität in großen Städten auf die Psyche vieler auswirken. Es gibt viele soziale Probleme. Der Bezug zur Natur und das Verständnis vom Zusammenhang von Ökologie und Ökonomie, von Menschen, Tieren und Umwelt fehlen vielen.
Wo fühlen Sie sich persönlich am wohlsten? In der Natur oder in der Stadt?
Ohne Zweifel in der Natur!
Was können die Menschen von den Schimpansen lernen, wenn es darum geht, ihren Lebensraum zu erhalten – und warum gelingt uns das offenbar nicht?
Es wäre so unendlich wichtig, endlich zu begreifen, dass ein ressourcenschonendes Leben und ein nachhaltiger Lebensstil für unser Überleben notwendig sind. Dieser Raubbau an unserem Planeten und die Rücksichtslosigkeit gegenüber der Natur aus Profitgründen und egoistischem Verhalten einiger Machthabender, aber auch die Ignoranz, die Respektlosigkeit und die Unwissenheit vieler Menschen machen es so schwer. Es ist unendlich wichtig, die Zerstörung von Lebensräumen zu stoppen und Ökosysteme zu bewahren – für unsere Zukunft und nachfolgende Generationen!
Was können wir Menschen tun, um den Schimpansen eine gute Zukunft zu bieten?
Sich für den Schutz ihres Lebensraums engagieren und endlich den Handel sowie den Missbrauch von Wildtieren stoppen. Nicht nur Schimpansen, auch andere Menschenaffen und Tiere sind vom Aussterben bedroht, da sie gejagt werden. Man muss sich vorstellen, dass der Handel mit Exoten nach dem illegalen Handel mit Drogen, Waffen und Menschen an vierter Stelle steht! Ein Milliardengeschäft, das das Artensterben ebenso vorantreibt wie die Zerstörung der Natur. Wie wichtig wäre es hier, sich für den Erhalt der Lebensräume und für den Schutz der Arten einzusetzen! Wir sollten uns stets vor Augen halten: Zerstören wir den Lebensraum von Tieren, so zerstören wir auch die Basis für unsere Existenz. Wir alle teilen uns diese einmaligen Ökosysteme und brauchen sie zum (Über-)Leben – ob den Regenwald, die Meere und Süßwassergebiete, die Böden und auch all jene von uns individuell gesehenen noch so fernen Gebiete. Es hängt auf diesem Planeten alles zusammen!
Was ist Ihre Botschaft an die Welt und insbesondere an junge Menschen, wenn Sie an die Notwendigkeit denken, unser Leben nachhaltiger zu gestalten? Ist es immer noch eine Botschaft der Hoffnung?
Definitiv. Es ist nicht zu spät und gerade gebe ich die Hoffnung nicht auf! Und ich appelliere unermüdlich an alle Generationen! Es gibt noch ein Zeitfenster für Änderungen, auch wenn es klein ist. Aber es ist da und wir dürfen die Hoffnung nicht verlieren! Wir sehen und wissen, dass es trotz allem viele Entwicklungen in die richtige Richtung gibt. Wir gelten als intelligenteste Spezies, haben heute so viele technische Möglichkeiten wie noch nie und können uns innerhalb kürzester Zeit mit Menschen weltweit vernetzten. So viele Menschen engagieren sich weltweit für ein friedliches Miteinander und für ihre Umwelt. Auf meinen Reisen sehe ich tausende Kinder und Jugendliche, die eine enorme Kraft haben und großartige Projekte realisieren. Aber auch Erwachsene, die ihnen zur Seite stehen und aktiv sind. Jede und jeder von uns kann an jedem Tag aufs Neue entscheiden, welchen Einfluss wir auf unsere Umwelt haben wollten. All diese positiven Bewegungen stehen den negativen Entwicklungen gegenüber. Und das lässt mich die Hoffnung nicht aufgeben!
Interview: Robert Seydel